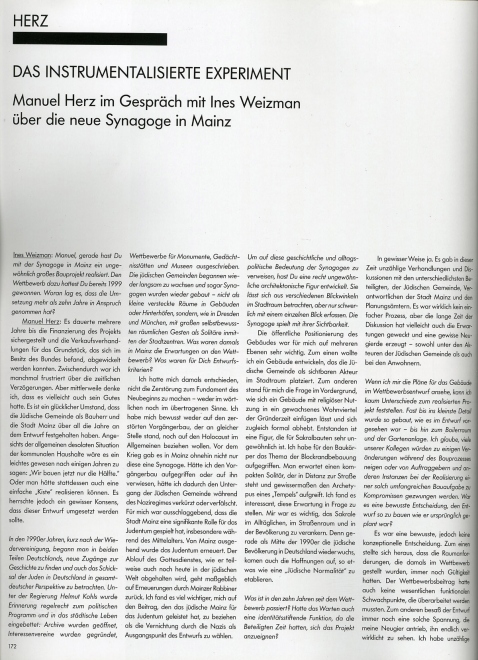
Gespräch zwischen Ines Weizman und Manuel Herz
Veröffentlicht in Arch Plus, Nr. 200, Okt. 2010
lnes Weizman: Manuel, gerade hast Du mit der Synagoge in Mainz ein ungewöhnlich großes Bauproiekt realisiert. Den Wettbewerb dazu hattest Du bereits 1999 Gewonnen. Woran lag es, dass die Umsetzung mehr als zehn Jahre in Anspruch genommen hat?
Manuel Herz: Es dauerte mehrere Jahre bis die Finanzierung des Projekts sichergestellt und die Verkaufsverhandlungen für das Grundstück, das sich im Besitz des Bundes befand, abgewickelt werden konnten. Zwischendurch war ich manchmal frustriert über die zeitlichen Verzögerungen. Aber mittlerweile denke ich, dass es vielleicht auch sein Gutes hatte. Es ist ein glücklicher Umstand, dass die Jüdische Gemeinde als Bauherr und die Stadt Mainz über all die Jahre an dem Entwurf festgehalten haben. Angesichts der allgemeinen desolaten Situation der kommunalen Haushalte wäre es ein leichtes gewesen nach einigen Jahren zu sagen; „Wir bauen jetzt nur die Hälfte.“ Oder man hätte stattdessen auch eine einfache „Kiste“ realisieren können. Es herrschte jedoch ein gewisser Konsens, dass dieser Entwurf umgesetzt werden sollte.
IW: In den 1990er Jahren, kurz nach der Wiedervereinigung, begann man in beiden Teilen Deutschlands, neue Zugänge zur Geschichte zu finden und auch das Schicksal der Juden in Deutschland in gesamtdeutscher Perspektive zu betrachten. Unter der Regierung Helmut Kohls wurde Erinnerung regelrecht zum politischen Programm und in das städtische Leben eingebettet: Archive wurden geöffnet, interessenvereine wurden gegründet, Wettbewerbe für Monumente, Gedächtnisstätten und Museen ausgeschrieben. Die jüdischen Gemeinden begannen wieder langsam zu wachsen und sogar Synagogen wurden wieder gebaut - nicht als kleine versteckte Räume in Gebäuden oder Hinterhöfen, sondern, wie in Dresden und München, mit großen selbstbewussten räumlichen Gesten als Solitäre inmitten der Stadtzentren. Was waren damals in Mainz die Erwartungen an den Wettbewerb? Was waren für Dich Entwurfskriterien?
MH: Ich hatte mich damals entschieden, nicht die Zerstörung zum Fundament des Neubeginns zu machen – weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Ich habe mich bewusst weder auf den zerstörten Vorgängerbau, der an gleicher Stelle stand, noch auf den Holocaust im Allgemeinen beziehen wollen. Vor dem Krieg gab es in Mainz ohnehin nicht nur diese eine Synagoge. Hätte ich den Vorgängerbau aufgegriffen oder auf ihn verwiesen, hätte ich dadurch den Untergang der Jüdischen Gemeinde während des Naziregimes verkürzt oder verfälscht. Für mich war ausschlaggebend, dass die Stadt Mainz eine signifikante Rolle für das Judentum gespielt hat, insbesondere während des Mittelalters. Von Mainz ausgehend wurde das Judentum erneuert. Der Ablauf des Gottesdienstes, wie er teilweise auch noch heute in der jüdischen Welt abgehalten wird, geht maßgeblich auf Erneuerungen durch Mainzer Rabbiner zurück. Ich fand es viel wichtiger, mich auf den Beitrag, den das jüdische Mainz für das Judentum geleistet hat, zu beziehen als die Vernichtung durch die Nazis als Ausgangspunkt des Entwurfs zu wählen.
IW: Um auf diese geschichtliche und alltagspolitische Bedeutung der Synagogen zu verweisen, hast Du eine recht ungewöhnliche architektonische Figur entwickelt. Sie lässt sich aus verschiedenen Blickwinkeln im Stadtraum betrachten, aber nur schwerlich mit einem einzelnen Blick erfassen. Die Synagoge spielt mit ihrer Sichtbarkeit.
MH: Die öffentliche Positionierung des Gebäudes war für mich auf mehreren Ebenen sehr wichtig. Zum einen wollte ich ein Gebäude entwickeln, das die Jüdische Gemeinde als sichtbaren Akteur im Stadtraum platziert. Zum anderen stand für mich die Frage im Vordergrund, wie sich ein Gebäude mit religiöser Nutzung in ein gewachsenes Wohnviertel der Gründerzeit einfügen lässt und sich zugleich formal abhebt. Entstanden ist eine Figur, die für Sakralbauten sehr ungewöhnlich ist. Ich habe für den Baukörper das Thema der Blockrandbebauung aufgegriffen. Man erwartet einen kompakten Solitär, der in Distanz zur Straße steht und gewissermaßen den Archetypus eines "Tempels" aufgreift. Ich fand es interessant, diese Erwartung in Frage zu stellen. Mir war es wichtig, das Sakrale im Alltäglichen, im Straßenraum und in der Bevölkerung zu verankern. Denn gerade als Mitte der 1990er die jüdische Bevölkerung in Deutschland wieder wuchs kamen auch die Hoffnungen auf, so etwas wie eine „Jüdische Normalität“ zu etablieren.
IW: Was ist in den zehn Jahren seit dem Wettbewerb passiert? Hatte das Warten auch eine identitätsstiftende Funktion, da die Beteiligten Zeit hatten, sich das Projekt anzueignen?
MH: In gewisser W eise ja. Es gab in dieser Zeit unzählige Verhandlungen und Diskussionen mit den unterschiedlichsten Beteiligten, der Jüdischen Gemeinde, Verantwortlichen der Stadt Mainz und den Planungsämtern. Es war wirklich kein einfacher Prozess, aber die lange Zeit der Diskussion hat vielleicht auch die Erwartungen geweckt und eine gewisse Neugierde erzeugt - sowohl unter den Akteuren der Jüdischen Gemeinde als auch bei den Anwohnern.
IW: Wenn ich mir die Pläne für das Gebäude im Wettbewerbsentwurf ansehe, kann ich kaum Unterschiede zum realisierten Projekt feststellen. Fast bis ins kleinste Detail wurde so gebaut, wie es im Entwurf vorgesehen war - bis hin zum Boilerraum und der Gartenanlage. Ich glaube, viele unserer Kollegen würden zu einigen Veränderungen während des Bauprozesses neigen oder von Auftraggebern und anderen Instanzen bei der Realisierung einer solch umfangreichen Bauaufgabe zu Kompromissen gezwungen werden. War es eine bewusste Entscheidung, den Entwurf so zu bauen wie er ursprünglich geplant war?
MH: Es war eine bewusste, jedoch keine konzeptionelle Entscheidung. Zum einen stellte sich heraus, dass die Raumanforderungen, die damals im Wettbewerb gestellt wurden, immer noch Gültigkeit hatten. Der Wettbewerbsbeitrag hatte auch keine wesentlichen funktionalen Schwachpunkte, die überarbeitet werden mussten. Zum anderen besaß der Entwurf immer noch eine solche Spannung, die meine Neugier antrieb, ihn endlich verwirklicht zu sehen. Ich habe unzählige Modelle und Animationen von dem Gebäude angefertigt und wollte endlich vor und im Gebäude stehen können.
IW: Man braucht dazu sicherlich auch ein gewisses Beharrungsvermögen. Das führt uns jedoch zu der Frage, ob das Gebäude nicht auch ein architekturhistorisches Dokument der 1990er darstellt? Oder anders gefragt : In welche Zeit, denkst Du, gehört das Gebäude - in die Neunziger oder in die erste Dekade des Millenniums?
MH: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich ist da etwas Unzeitliches in diesem Projekt. Inzwischen hatten sich viele technische Fragen, wie zum Beispiel die Keramikfassade oder die Innenraumgestaltung der Synagoge durch neue Technologien und Materialien gelöst. Zum anderen ist der Entwurf in den 1990ern konzipiert worden und konnte damals nur als Zeichnung diskutiert werden. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man ein Gebäude heutzutage noch zeitlich klar verankern kann. Heute ist ein Gebäude schon nach zwei Wochen nicht mehr aktuell, weil es dann bereits in allen Blogs aufgetaucht ist. Wir glauben, ein Gebäude mit zwei oder drei Bildern erfasst zu haben und beurteilen zu können. Spielt es wirklich eine Rolle, ob der Entwurf vor zehn Jahren entwickelt wurde?
IW: Vielleicht können wir mal kurz versuchen, diese Situation historisch zu lesen? Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es Juden in Deutschland gewährt, Synagogen als repräsentative, im Straßenbild deutlich sichtbare Bauten zu errichten. Diese Gebäude, die plötzlich das jüdische Leben öffentlich machten, beschrieben nun auch ein neues architektonisches Problem. Beim Entwurf der Synagoge in Dresden entschied sich Gottfried Semper, die Straßenfassade in neoromanischem Stil und den Innenraum mit orientalischen Elementen und Ornamenten zu gestalten. Auch bei anderen Synagogenbauten dieser Zeit wurden romanische und gotische Elemente ganz gezielt gewählt, um die Sakralbauten so organisch wie möglich in den kulturellen und baulichen Kontext in Deutschland einzubetten, aber auch um ein nationales – d. h. deutsches – Selbstverständnis darzustellen. Aber viel häufiger wurden maurisch-byzantinische Elemente gewählt, wie zum Beispiel bei der großen Frankfurter Synagoge. Das Jüdische wurde vor allem als das „Andere“, das „Orientalische“ gelesen und in der Architektur der Synagoge unmissverständlich dargestellt. In dieser sehr kurzen Phase bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Juden als die einzigen Nichteuropäer (Araber) in Deutschland akzeptiert. Nach dem Holocaust und dem zweiten Weltkrieg sah man sie als die Europäer des Nahen Ostens. Können wir heute solche Sinnverschiebungen in der Architektur noch ablesen?
MH: Eigentlich kann man für das 19. Jahrhundert vereinfacht dargestellt zwei Architekturströmungen im Synagogenbau beschreiben. Diese entstammen zwar der gleichen Argumentationslinie, können aber unterschiedlicher nicht sein. Mit dem Erlangen der allgemeinen Bürgerrechte glaubten manche Jüdischen Gemeinden, ihre Emanzipation dadurch darstellen zu können, dass sie im neogotischen Stil bauten. Diese Architektur stiftete klare Bezüge zur deutschen bürgerlichen Identität und ließ Synagogen entstehen, die sich im Prinzip nicht von Kirchen unterschieden. Aus der gleichen Argumentation heraus glaubten andere Jüdische Gemeinden, ihrer vermeintlichen Andersartigkeit durch einen ebenso vermeintlich autochthonen, nämlich orientalisierenden Baustil, Ausdruck zu verleihen. Beides waren natürlich geborgte Stile und so schwankte auch die Selbstwahrnehmung der Juden in Deutschland zwischen dem "Araber" und dem bürgerlich Angepassten. Bis in das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hinein sehen wir in Deutschland Synagogen, die eine "gepflegte Andersartigkeit" darstellen. Es sind, wie schon erwähnt, Synagogen, die auffallen, die sich zum Teil nicht an städtebauliche Richtlinien halten, denen aber dieser Freiraum eingeräumt wird. Es sind Bauten eines instrumentalisierten Experiments. Zu dieser Art gehören die expressiven Synagogen Zvi Heckers oder auch meine, sowie die kubischeren, wie die von Wandel Höfer Lorch in Dresden und München. Sie markieren, wenn auch formal anders gelöst, einen ausdrücklichen Bruch im Stadtraum. In der allerjüngsten Zeit sehen wird jedoch eine neue Entwicklung. Bei den letzten beiden Synagogenwettbewerben in Potsdam und Ulm wurden Beiträge prämiert, die aus ihrem städtebaulichen Kontext in keiner Weise hervortreten. Man könnte sie fast als banale Bauten bezeichnen. Vielleicht hat hier das Konzept der "Normalität" seine letzte Stufe erreicht. Man betet nicht mehr in skulpturaler Expressivität. Man betet jetzt in Bürogebäuden.
IW: Das erinnert mich an einen Entwurf von Fritz Landauer aus den 1920er Jahren. Er gestaltete die Synagoge in Plauen ganz im Sinne des Neuen Bauens, funktional und modern - fast wie ein Postgebäude. Sachlichkeit und religiöse Kontemplation waren für ihn kein Widerspruch. Versuchen die Entwürfe für Potsdam und Ulm Verbindungen zu dieser durch die Nazis unterbrochenen Tradition zu finden? Hat sich Deiner Meinung nach die Erscheinung religiöser Gebäude im öffentlichen Raum in den letzten zehn Jahren geändert? Was ist ihre Bedeutung? Ich selbst habe miterlebt, wie in der DDR religiöse Stätten politische bzw. zwischenmenschliche Begegnungen ermöglichten. Von diesen Orten ging letztlich eine riesige Bürgerrechtsbewegung aus, die den räumlichen und kulturellen Kontext der Kirche weit überstieg. Denkst Du, so etwas wäre heute auch möglich? Haben religiöse Institutionen heutzutage auch eine zivile Rolle?
MH: Ja, natürlich. Ich kann als Architekt natürlich nicht die möglichen Inhalte oder zivilen Aufgaben "programmieren". Aber ich kann versuchen, mit architektonischen und städtebaulichen Mitteln ein Potential zu erzeugen, das über die eigentliche Nutzung hinausgeht. Ich möchte hier zwei Beispiele anführen: Durch das Aufgreifen der Blockrandbebauung für den Baukörper entsteht ein Synagogenvorplatz der sich nicht durch Zäune, Mauern oder sonstige Barrieren abschottet, sondern ein wirklich öffentlicher Ort ist. In der dicht bebauten Mainzer Neustadt stellt dieser Platz einen der wenigen Freiräume dar, den alle Anwohner des Quartiers nutzen können. Auch der Veranstaltungssaal des Gemeindezentrums steht für öffentliche Nutzungen zur Verfügung. Und, auch wenn es nur ein kleines Detail sein mag: Der Bau steht ohne Sockel oder Aufkantung auf dem Boden. Ich wollte ein Gebäude gestalten, das man ohne Ehrfurcht betreten kann, und welches – auch wenn die expressive Form dem eventuell widerspricht – etwas Alltägliches hat. Diese Alltäglichkeit ist meiner Meinung nach Voraussetzung dafür, dass Orte, die eigentlich religiös genutzt werden, eine andere, zusätzliche und vielleicht auch politische Bedeutung erlangen können.
IW: Es scheint mir, dass da eine Beziehung zwischen der hohen Sichtbarkeit von Synagogen und den im Stadtraum fast unsichtbar bleibenden Moscheen besteht. In den letzten Tagen erst hörten wir von sehr heftigen Auseinandersetzungen und Kontroversen am Ground Zero in New York, in dessen Nähe eine Moschee gebaut werden soll. Erst vor einem Jahr wurde in der Schweiz per Volksentscheid ein Bauverbot für Minarette beschlossen. Dagegen können wir besonders in den früheren kommunistischen Ländern sehen, wie Religion regelrecht zurückkehrt, ein Phänomen, das Boris Buden als Post-Säkularismus beschrieben hat. Die Mainzer Synagoge wurde mit einem Staatsakt und mit viel Aufmerksamkeit in fast allen Feuilletons der großen Tageszeitungen gefeiert. Ich frage mich, ob hier Synagogen, Kirchen und Moscheen Teil derselben Geschichte sind?
MH: Kirchen, Synagogen und Moscheen sind zum Instrument dreier unterschiedlicher gesellschaftspolitischer Diskurse geworden. Synagogen spiegeln den Versuch wider, eine "Normalität" des deutsch-jüdischen Verhältnisses auszudrücken und zur Verarbeitung des Holocausts beizutragen. Kirchenbauten hingegen wurden in den letzten Jahren in der Architekturdiskussion eher in den Kategorien "Umgang mit Leerstand" oder "Funktionale Umnutzung" behandelt. Die überzogenen und oft emotionsgeladenen Diskussionen zu Moscheeneubauten zeigen letztlich natürlich die Angst vor einer vermeintlichen Überfremdung und die Unfähigkeit des Westens mit dem „Anderen“ umzugehen. Im Grunde genommen geht es bei den drei Diskursen schon längst nicht mehr um religiöse, sondern um spezifisch gesellschaftspolitische und kulturelle Fragestellungen. Wenn es wirklich so etwas wie einen Post-Säkularismus gibt, so ist er lediglich ein politisches Kampfmittel neben anderen.
